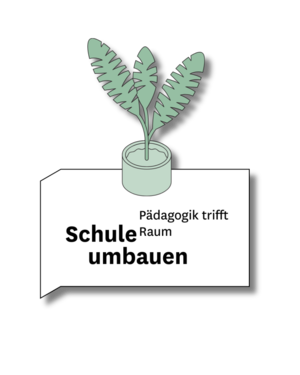FAQ: Startchancen
Startchancen-Programm Säule I - Pädagogische Architektur
Das über zehn Jahre laufende Startchancen-Programm ist eine Chance, Ziele auf pädagogischer, organisatorischer und räumlicher Ebene anzugehen. Im Folgenden haben wir zentrale Fragen und Antworten zusammengestellt, die wir im Rahmen unserer Projekte an der Schnittstelle von Pädagogik und Architektur bearbeitet haben.
Veranstaltungshinweis: "Startchancen Säule I im Gespräch"
Mit unserer digitalen Veranstaltungsreihe bieten wir die Gelegenheit, mit unseren Projektleitungen aus den Disziplinen Pädagogik und Architektur ins Gespräch zu kommen und Anregungen für die Umsetzung des Ganztagsausbaus und des Startchancenprogramms zu bekommen. Online via WebEx und ohne Anmeldung:
- Freitag, 23. Januar 2026 | 10-11:30 Uhr | „Zukunftsgerichtete Lernräume im Bestand“ mit Dorle Zweering, Dipl.-Ing. Innenarchitektur, gernot schulz : architektur
- Freitag, 20. März 2026 | 10:30-12 Uhr | „Veränderte Möblierung für eine lernförderliche Umgebung“ mit Hanne Banduch, Dipl.-Ing. Fachrichtung Architektur & Karolin Kaiser, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin AKHH, büro luchterhandt & partner
- Donnerstag, 23. April 2026 | 10:30-12:00 Uhr | „Veränderte Brandschutzkonzepte in Bestandsgebäuden“ mit Prof. Dr.-Ing. Dirk Lorenz, IBC Ingenieurbau-Consult GmbH, Mainz
Mehr Informationen und die Zugangslinks finden Sie auf unserem Blog “Schulen planen und bauen”.
Um die Mittel wirksam einzusetzen, braucht es vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen eine inhaltliche Verknüpfung der drei Säulen des Startchancen-Programms: Zentral ist es, die Bedarfe zuvor in einem Prozess zu ermitteln. Dabei bildet die pädagogische Entwicklung den Ausgangspunkt für die räumliche Anpassung.
Eine solche Verknüpfung bietet unser Projekt „Ganztag und Raum“, das räumlich-pädagogische Konzepte für eine qualitative ganztägige Bildung im Bestand entwickelt. Die baulichen Maßnahmen (Säule I) basieren dort auf einem vorgeschalteten pädagogischen Prozess zur Schulentwicklung (Säule II), in dem die Bedarfe durch ein multiprofessionelles Team (Säule III) ermittelt werden.
Beispiele für Maßnahmen aus unseren Projekten, die über Säule I gefördert werden:
- Investitionen in die Bildungsinfrastruktur: Sie sind förderfähig, wenn sie zu einer zeitgemäßen, inklusiven und lernförderlichen Umgebung und somit unmittelbar oder mittelbar zu einer Motivations- und Kompetenzsteigerung der Schüler*innen beitragen und die Vernetzung der Schulen in den Sozialraum fördern. Im Projekt Ganztag und Raum lag der Fokus auf Grundschulen im Bestand. Das Startchancen-Programm bezieht sich sowohl auf Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf Schulgebäude, -anlagen und -gelände sowie digitale Ausstattung. Beispiele hierzu können der Verwaltungsvereinbarung § 2 (2) entnommen werden.*
- Möbel und Ausstattung: Sie sind förderfähig, wenn sie pädagogische Ziele wie individuelles, bewegtes Lernen oder kooperative Arbeitsformen unterstützen. Spezielle Lernumgebungen (z. B. Werkstätten, Fachräume, Ruhe- oder Rückzugsbereiche) können ebenso finanziert werden, wie die pädagogisch begründete Umgestaltung von Außenbereichen, z. B. Bewegungsangebote, Lernorte im Freien (z. B. grüne Klassenzimmer) und Maßnahmen zur Umsetzung von Inklusion.
- Planungsleistungen und externe Prozessbegleitungen: Sie sind zum Beispiel förderfähig zur Bedarfsermittlung (Phase Null), Konzeptentwicklung oder Maßnahmenplanung im Vorfeld baulicher Umsetzung.
*Vgl. Bundesrepublik Deutschland (2024): Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104c des Grundgesetzes zur Umsetzung der Säule I des Startchancen-Programms (Investitionsprogramm Startchancen)
Das Startchancen-Programm zielt spezifisch auf die Qualitätssteigerung der Lernbedingungen und -umgebungen auf allen Ebenen. Maßnahmen lassen sich danach zum Beispiel wie folgt abgrenzen:
- förderfähig über Säule I: kleinere bauliche Maßnahmen, wenn sie zur Verbesserung der Lernumgebung und zur pädagogischen Zielsetzung der schulischen Entwicklungsplanung beitragen, z. B. Schaffung von Transparenzen und Öffnungen zwischen den Räumlichkeiten, akustische Anpassungen (s. hierzu auch Akustik im Schulbau), Möblierung, die Schaffung von Differenzierungs- oder Rückzugsräumen, die Umwandlung von Flurbereichen zu pädagogisch nutzbarer Fläche durch ein verändertes Brandschutzkonzept.
- nicht förderfähig: reine Schönheitsreparaturen oder Maßnahmen, die in die reguläre Bauunterhaltung fallen. Dennoch sollten diese Instandhaltungsmaßnahmen bei der Umsetzungsplanung mitgedacht und frühzeitig mit kommunalen Stellen abgestimmt werden, um einen effizienten Ablauf und eine möglichst geringe Belastung des Schulbetriebs zu gewährleisten. So wird Schulumbau ganzheitlich betrachtet, bei dem durch eine veränderte Flächennutzung und gezielte kleinere Umbauten qualitativ hochwertige Lernumgebungen entstehen.
Pädagogisch und baulich nachhaltige Lösungen entstehen durch einen Prozess, in dem Schulentwicklung, Organisationsentwicklung und Raumnutzung gemeinsam gedacht werden. Die baulichen Maßnahmen (Säule I) beruhen dann auf einer im Vorfeld definierten zukunftsgerichteten Pädagogik (Säule II), die ein multiprofessionelles Team (Säule III) in einem vorgeschalteten pädagogischen Prozess gemeinsam entwickelt.
Wie das konkret aussehen kann, zeigen unsere Projekte „Ganztag und Raum“. Hier erarbeiten wir in einem gemeinsamen Prozess integrierte Nutzungskonzepte, die die pädagogische und organisatorische mit der räumlichen Ebene verbinden. Durch eine veränderte Nutzung vorhandener Räume, neue Möblierung und minimale bauliche Eingriffe kann so ein qualitativer Ganztag entstehen – ohne kosten- und ressourcenintensive Neu- und Anbauten. Die Voraussetzungen dafür liegen in der Schulentwicklungsarbeit, einem gemeinsamen Bildungsverständnis und einer schüler*innenorientierten Rhythmisierung.
- Viele Bundesländer und Schulträger bieten Arbeitshilfen, Checklisten, Vorlagen und Informations- und Netzwerkformate zur Umsetzung an.
Die Beteiligung aller Akteur*innen mit ihren verschiedenen Perspektiven von Anfang an unterstützt die Ausarbeitung eines ganzheitlichen Konzepts für eine qualitative Lernumgebung – und im Zusammenspiel aller drei Säulen.
Teil des Prozesses sind Schulleitung, Ganztagsleitung, Schulträger, Bauverwaltung inkl. Brandschützer*innen, Ganztagsträger, Schulaufsicht, Jugendhilfeträger, ggf. Bildungsbüro. Innere und äußere Schulangelegenheiten werden in einer Verantwortungsgemeinschaft zusammengedacht.
Auch die Einbindung von Lehrkräften, Schulsozialarbeit, pädagogische Mitarbeiter*innen, Schüler*innen und ggf. Eltern in Workshops, Arbeitsgruppen oder Umfragen fördert das Ergebnis. So kann das Projekt als Impuls für Schulentwicklung genutzt werden und mit dem erarbeiteten Konzept dargelegt werden, wie die geplanten Investitionen das Lernen, die Chancengleichheit und die individuelle Schulentwicklung unterstützen. Landesspezifische Vorgaben und Fristen sind zu beachten.
Wir empfehlen außerdem, den Prozess aus pädagogischer und architektonischer Sicht begleiten und steuern zu lassen.
In der Konzeptentwicklung und bei der Ermittlung der nötigen Maßnahmen können Prozessbegleitungen aus den Bereichen Pädagogik/Schulentwicklung und Architektur fachliche Unterstützung bieten. Zu den Kernaufgaben der Prozessbegleitung gehören die Analyse schulspezifischer Bedarfe, eine pädagogische Begleitung und Beratung, die Entwicklung eines pädagogisch-räumlichen Nutzungskonzepts und die Entwicklung von konkreten Umbaumaßnahmen. Sie können über Mittel aus Säule I (Architektur) bzw. II (Schulentwicklung) finanziert werden. Die Beauftragung erfolgt durch den Schulträger in Abstimmung mit Schule oder durch die Bauverwaltung. Externe Prozessbegleitungen unterstützen die partizipative Konzeptentwicklung, organisieren und steuern den Prozess, bringen Expertise ein, verbinden die Perspektiven aller beteiligten Akteur*innen und formulieren notwendige Maßnahmen.
Geeignete Fachpersonen finden sich über gelungene Praxisbeispiele anderer Schulen und Kommunen, über Fachartikel, Veranstaltungen und Pilotprojekte z.B. der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft. Zu empfehlen ist ein Team aus Pädagogik und Architektur zu beauftragen, da beide Expertisen gebraucht werden. Ggf. können auch Architektenkammern auf Schulbau spezialisierte (Innen-)Architekt*innen und pädagogische Landesinstitute entsprechende Schulentwickler*innen vermitteln. Thematisch passende Hospitationsschulen findet man zum Beispiel in den Schulportraits des Deutschen Schulpreises.
Darüber hinaus bieten auch die Länder unterschiedliche Unterstützungsstrukturen und stellen Personen, die auf verschiedenen Ebenen bei der Umsetzung und beim Dialog begleiten. Informationen dazu finden Sie auf den jeweiligen Länderwebseiten oder über den zuständigen Schulträger.
Jede Schule benötigt aufgrund ihrer besonderen Rahmenbedingungen einen eigenen Prozess – doch nicht jede Schule muss diesen Prozess separat durchlaufen. Themen wie Brandschutz, Möblierung, multiprofessionelle Teamarbeit oder eine veränderte Rhythmisierung lassen sich z. B. in gemeinsamen Auftaktformaten bearbeiten und anschließend schulspezifisch vertiefen. Räumliche Synergien lassen sich auch durch die Zusammenarbeit mehrerer Schulen einer Kommune entwickeln.
Ein wirksamer Schulumbau betrachtet die Schule und das umgebende Quartier als ganzheitlichen Lern- und Lebensraum. Ausgangspunkt für die Planung eines Umbaus ist immer ein pädagogisches Konzept. Auf dieser Grundlage werden dann räumliche Anforderungen und Optionen im Bestand definiert und in eine architektonische Planung übersetzt. Dazu gehört in der Regel die gemeinsame Nutzung der Flächen über den ganzen Tag hinweg – orientiert an pädagogischen Anforderungen und Aktivitäten.
Viele Schulen, die ihren Ganztag weiterentwickeln wollen, sind noch in additiven Strukturen organisiert: Vormittags findet der Unterricht statt, nachmittags die „Betreuung“. Durch Klassenraumsysteme und monofunktionale Räumlichkeiten stehen dabei einzelne Räume zeitweise leer. Die Herausforderung ist dann, etablierte Abläufe zu ändern – die Chance ist gleichzeitig, dass alle ungenutzten Räume und Flächen viel Potenzial für neue Lösungen bieten.
Zeitgemäße Ansätze lösen sich von festen Klassen- und Fachraumstrukturen und organisieren Räume nach Tätigkeiten wie konzentrierte Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Inputphasen, Begegnung, Rückzug oder Bewegung.
Durch veränderte Brandschutzkonzepte und den Einbau von Sichtverbindungen durch Wandöffnungen, Glastüren oder Glaswände können Flure zu pädagogisch nutzbaren Flächen werden. Auch die Möblierung spielt eine zentrale Rolle. Ein integriert entwickeltes Möbel- und Farbkonzept unterstützt unterschiedliche Lehr- und Lernformate und bietet vielfältige Lernsettings. Ganztägige Bildung erfordert zudem Rückzugs- und Bewegungsflächen im Gebäude und im Außenraum.
Konkrete Lösungen lassen sich zunächst testen, bevor sie im Schulalltag etabliert werden. Besonders Projektwochen oder -tage können einen Rahmen hierfür bieten. So können neue Nutzungskonzepte erprobt, evaluiert und angepasst werden.
In einigen Bundesländern erschweren veraltete Gesetze und Vorschriften es, zeitgemäße Konzepte für innovativen Schulbau zu planen und umzusetzen – besonders im Bereich Brandschutz. Bereits kleine Änderungen oder Nutzungsanpassungen erfordern dann einen formellen Bauantrag, der wiederum weitere Anforderungen mit sich bringt und so zusätzliche Hürden schafft. Lösungen für diese Herausforderungen bieten zum Beispiel unsere Broschüre „Brandschutz im Schulbau – Neue Konzepte und Empfehlungen“ sowie die Onlineplattform „Schulbau Open Source“. Sie geben Anregungen, konkrete Hinweise und Beispiele, wie innovativer Schulbau mit geltenden Anforderungen zusammengebracht werden kann.
Im Gegenteil: Die grundlegenden Ziele des Brandschutzes –Brandvermeidung, Verhinderung der Ausbreitung, Brandbekämpfung und Rettung – widersprechen keineswegs den pädagogischen Anforderungen an zeitgemäße Lernräume. Durch mehr Transparenz und bessere Übersichtlichkeit innerhalb von Clustern und offenen Lernlandschaften kann die Brand- und Raucherkennung sogar schneller erfolgen als in Klassenraum-Flur-Schulen. Durch die Bildung von Bereichen kann auf „notwendige Flure“ (brandschutztechnisch „sicherere“ und brandlastfreie Flure zur Führung der Rettungswege) verzichtet werden. Das eröffnet neue Möglichkeiten für offenere Raumkonzepte.
Rahmenvertragspartner können ggf. auch selbst zu neuen Lösungen beitragen. Darüber hinaus besteht bei Rahmenverträgen in der Regel die Möglichkeit, weitere Anbieter zu beauftragen, zum Beispiel, wenn andere Möblierungsformen gebraucht werden als die dort vorgesehenen. Bei maßgeschneiderten Lösungen, insbesondere bei Festeinbauten, ist eine Ausschreibung von Planung und Ausführung durch das Schreinergewerk über die Bauverwaltung vorgesehen. Feste und lose Möblierung werden dabei in einem ganzheitlichen Konzept gemeinsam geplant, um ein stimmiges und funktionales Raumangebot zu gewährleisten.
Klare Strukturen und Rollen schaffen: Die Einrichtung einer Projekt- und Steuergruppe mit regelmäßigen Austauschformaten trägt dazu bei, einen gemeinsamen Informationsstand zu gewährleisten und Aufgaben effizient zu verteilen. Arbeitsgruppen oder Austauschformate mit anderen Kommunen oder Schulen können zusätzlich unterstützen.
Zielstellungen, Meilensteine, Maßnahmen definieren und priorisieren, Veränderungen und Fortschritte frühzeitig sichtbar machen und zeigen: Bereits durch Umstrukturierungen der vorhandenen Räumlichkeiten oder Ausstattung können neue Lernsettings erprobt, evaluiert und bei Bedarf angepasst werden – und das ganz ohne große Neuanschaffungen. Projekttage eignen sich besonders gut, um Neues frei auszuprobieren und dabei Fehler zuzulassen. Auch einzelne Personen können neue Ansätze im kleinen Rahmen testen und ihre Erfahrungen mit dem Team teilen oder durch gegenseitige Hospitationen Impulse geben. So bleiben alle Beteiligten eingebunden und gestalten den Wandel gemeinsam mit. Entscheidend ist ein offener Rahmen, der zum Ausprobieren und Handeln motiviert – in einem gut gesteuerten und organisierten Prozess.
Hinweis: Die Rahmenbedingungen und Abläufe sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich und wurden zum Teil noch nicht vollständig festgelegt.