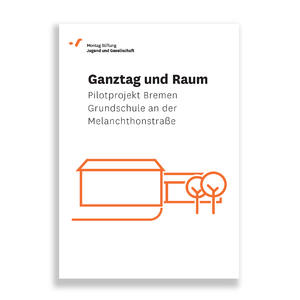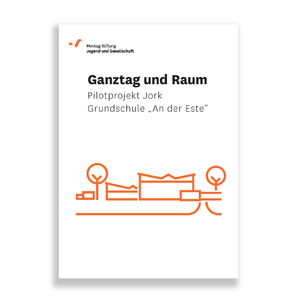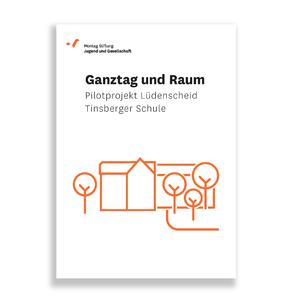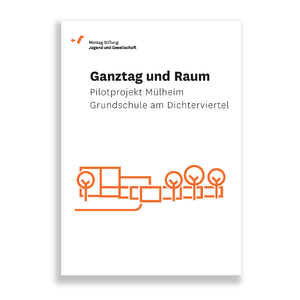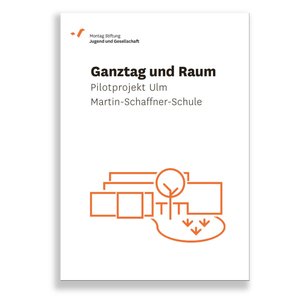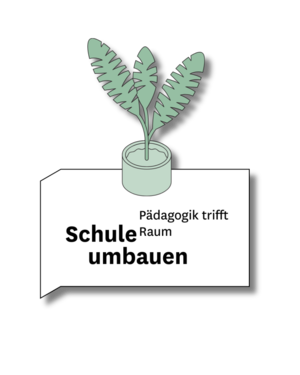Ganztag und Raum
Neue Konzepte für bestehende Räume
Wie kann der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Bestandsgebäuden umgesetzt werden? In fünf Pilotprojekten sind gemeinsam mit Schule, Jugendhilfe, Kommune und Schulaufsicht neue Nutzungskonzepte entstanden. Sie zeigen: Ein kindgerechter Ganztag im Bestand ist möglich, wenn Pädagogik, Raum und Organisation zusammengedacht werden.
In Zukunft hat jedes Kind im Grundschulalter das Recht auf einen Platz zur ganztägigen Förderung. Das sieht das Ganztagsförderungsgesetz vor, das ab 2026 stufenweise umgesetzt wird. Für viele Kommunen und Schulen bedeutet das: Der Bedarf an Ganztagsplätzen nimmt zu.
Das stellt sie vor personelle, finanzielle und räumliche Herausforderungen. Denn das ohnehin begrenzte räumliche Angebot wird oft noch nach dem Modell „vormittags Schule, nachmittags Betreuung“ getrennt voneinander genutzt. Dabei wird viel Potenzial verschenkt. Durch die Verbindung von Pädagogik und Architektur kann es gelingen, den Ganztag neu zu organisieren – und die vorhandenen Flächen optimal zu nutzen.
Das Projekt unterstützt Ganztagsschulen im Primarbereich auf ihrem Weg zu einer neuen Praxis im Umgang mit Raum und Fläche. Es entstehen neue Nutzungskonzepte, die die pädagogische, räumliche und organisatorische Perspektive verbinden.
Durch ein angepasstes Brandschutzkonzept, minimale Umbaumaßnahmen (Sichtverbindungen, Nischen etc.) sowie eine veränderte Möblierung werden vorhandene Räume und Flächen effektiver genutzt – unter Einbezug des Quartiers.
Das Konzept hat die Stiftung bereits an fünf Pilotschulen mit einem interdisziplinären Prozessbegleitungsteam aus Pädagogik und Architektur umgesetzt. Der Prozess umfasste Workshops, Projektwochen und Exkursionen mit allen Projektbeteiligten: Lehrkräften, pädagogischen Mitarbeitenden, Kindern, Schulträger, Träger der Jugendhilfe, Bauverwaltung und Schulaufsicht.
Nach der operativen Begleitung der Pilotprojekte entsteht aktuell ein Weiterbildungskonzept für Pädagog*innen und Architekt*innen, die solche Prozesse auf kommunaler Ebene begleiten.
Andere Schulen können im Zuge der Umsetzung des Ganztagsausbau und des Startchancen-Programms die Prozesse und Konzepte aus den Pilotprojekten als Grundlage für ihre eigene Ganztagsentwicklung und Umbauten nutzen. Die Dokumentationen und Ergebnisse zu allen Pilotprojekten sind online frei verfügbar. Sie werden durch öffentliche Netzwerkveranstaltungen ergänzt. Dieses Wissen bildet auch eine Basis für die Umsetzung des Startchancen-Programms.
Im "FAQ Startchancen Säule I" sind zentrale Fragen und Antworten zusammengestellt, die im Rahmen der Projekte der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft an der Schnittstelle von Pädagogik und Architektur bearbeitet wurden.
Fünf Pilotprojekte, fünf Standorte
Das erste Pilotprojekt fand 2022/2023 an der Martin-Schaffner-Schule in Ulm statt. Die weiteren vier Pilotprojekte wurden aus über 40 bundesweiten Bewerbungen ausgewählt und 2023/2024 jeweils durch ein multiprofessionelles Prozessbegleitungsteam in Zusammenarbeit mit der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft begleitet.
2022/23
- Ulm: Martin-Schaffner-Schule
2023/24
- Bremen: Schule an der Melanchthonstraße
- Jork: Grundschule an der Este
- Lüdenscheid: Grundschule Tinsberg
- Mülheim an der Ruhr: Grundschule am Dichterviertel
Publikationen und Veranstaltungen
- Startchancen Säule I im Gespräch (Online-Veranstaltung)
- Architektur folgt Pädagogik: Wie die Umsetzung von Säule I des Startchancen-Programms gelingen kann (Blogbeitrag)
- Ein Jahr Startchancen-Programm: Einblicke in die Herausforderungen aus der Praxis und Handlungsempfehlungen (Blogbeitrag)
- FAQ Ganztag und Raum (Blogbeitrag)
- FAQ Startchancen Säule I
- Filmische Einblicke in die Prozesse der Pilotprojekte Ganztag und Raum